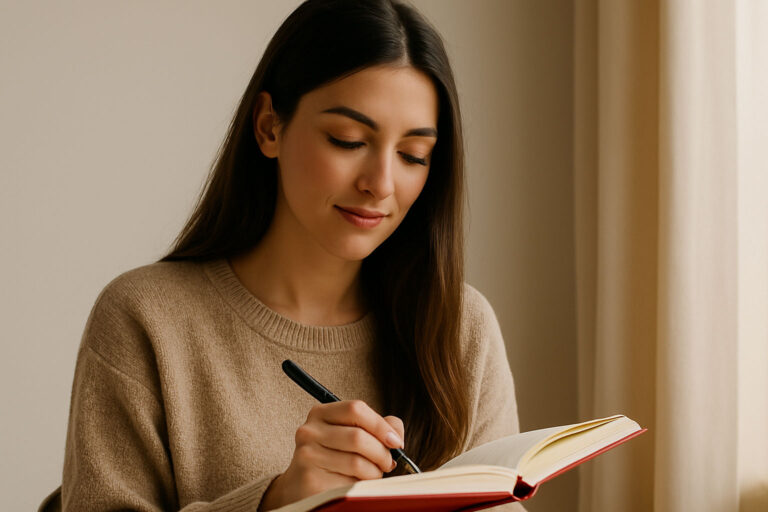Das Karen-Phänomen: Wenn privilegiertes Verhalten viral geht
Das Karen-Phänomen hat sich in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten Internet-Memes entwickelt. Es beschreibt eine meist weiße Frau mittleren Alters, die durch überzogenes Anspruchsdenken, aggressives Auftreten und häufig rassistisch gefärbtes Verhalten auffällt – oft gegenüber People of Color. Das Meme ist längst mehr als ein Social-Media-Scherz: Es spiegelt gesellschaftliche Machtstrukturen wider und wird zunehmend wissenschaftlich untersucht.
Ursprung und Verbreitung des Karen-Memes
Die Figur „Karen“ tauchte in den späten 2010er-Jahren in sozialen Medien auf, zuerst in humorvollen Kontexten, später verstärkt im Zusammenhang mit dokumentierten Fällen von Alltagsrassismus. Besonders während der COVID-19-Pandemie wurde der Begriff zum Synonym für Menschen, die Regeln missachten, aggressiv auftreten oder Privilegien demonstrativ ausspielen.
Wissenschaftliche Studien zum Karen-Phänomen
Mehrere Studien haben das Phänomen aus soziologischer, linguistischer und juristischer Perspektive analysiert:
- Blitvich et al. (2022) fanden heraus, dass die „Karen“-Identität in viralen Videos oft durch wiederkehrende sprachliche Muster konstruiert wird: ein autoritärer Tonfall, Unterbrechungen, Forderungen nach Vorgesetzten („Can I speak to the manager?“) und die Betonung eigener Rechte, oft in einem Kontext, der soziale Normen verletzt. Die Autor:innen betonen zudem häufige Charaktereigenschaften wie geringe Empathie, starkes Anspruchsdenken, Dominanzstreben und eine ausgeprägte Selbstwahrnehmung als moralisch im Recht stehend.
- Rosen et al. (2021) zeigten, dass Betroffene, die als „Karen“ viral gehen, nicht nur unter öffentlicher Bloßstellung leiden, sondern auch erhebliche berufliche und rechtliche Konsequenzen erfahren können – von Jobverlust bis zu gerichtlichen Verfahren. Ihre Analyse deutet darauf hin, dass viele dieser Frauen aus sozioökonomisch stabilen bis privilegierten Verhältnissen stammen und häufig zwischen 35 und 55 Jahre alt sind.
- Buchanan (2020) stellte fest, dass „Karen“ als kulturelles Symbol tief in historischen Machtstrukturen verankert ist. Das Verhalten wird als moderner Ausdruck einer langen Tradition weißer Vorherrschaft und sozialer Kontrolle verstanden, die bis in die Zeit der Sklaverei zurückreicht. Er verweist darauf, dass viele dokumentierte „Karen“-Fälle aus suburbanen Milieus stammen, in denen Homogenität und sozioökonomische Sicherheit vorherrschen.
Darüber hinaus zeigen Social-Media-Analysen, dass das „Karen“-Verhalten zunehmend auch nachgestellt oder inszeniert wird, um gezielt Aufmerksamkeit zu generieren und Reaktionen – von Empörung bis Belustigung – zu provozieren. Solche inszenierten Szenen verstärken die Verbreitung des Memes, können jedoch die öffentliche Wahrnehmung zusätzlich verzerren.
Gesellschaftliche Bedeutung
Das Karen-Meme ist mehr als ein Internetwitz – es ist ein Spiegel gesellschaftlicher Dynamiken. Es macht sichtbar, wie Privilegien, Rassismus und soziale Macht in alltäglichen Interaktionen wirken. Gleichzeitig gibt es eine Debatte darüber, ob der Begriff selbst sexistisch oder ageistisch ist, da er gezielt Frauen mittleren Alters stigmatisiert.
Kritik und Kontroversen
Während viele den Begriff als notwendige Kritik an diskriminierendem Verhalten sehen, warnen andere vor einer pauschalen Stigmatisierung. Problematisch wird es, wenn berechtigte Beschwerden von Frauen vorschnell als „Karen-Verhalten“ abgetan werden – was legitime Anliegen delegitimieren kann.
Human Code Perspektive: Medienkompetenz und respektvolles Miteinander
Das Karen-Phänomen ist ein komplexes Zusammenspiel aus Medienkultur, Machtstrukturen und sozialer Wahrnehmung. Wissenschaftliche Studien helfen, das Meme über den humoristischen Kontext hinaus zu verstehen und gesellschaftliche Mechanismen dahinter zu erkennen.
Im Kontext des Human Code verdeutlicht es die Relevanz von Medienkompetenz: Nur wer Inhalte kritisch hinterfragt und den Ursprung von Memes, Trends und viralen Phänomenen versteht, kann Manipulation, Vorurteilen und falschen Narrativen wirksam begegnen. Ein Verhalten, das auf Abwertung, Aggression und Dominanz beruht – ob real oder inszeniert – trägt nicht zu einem respektvollen Miteinander bei. Im Gegenteil: Es untergräbt Vertrauen, Empathie und soziale Kohäsion – zentrale Bausteine einer gesunden Gemeinschaft.
Literaturverzeichnis:
- Blitvich, P. G.-C. et al. (2022). Karen: Stigmatized social identity and face-threat. Journal of Pragmatics. DOI-Link
- Rosen, J. et al. (2021). Karen Ever After: The Career & Legal Consequences of being the Racist White Lady in an Internet Meme. ResearchGate.
- Buchanan, L. (2020). Querying Karen: The Rise of the Angry White Woman. ResearchGate.
- Harvard Law School (2020). Deconstructing the ‘Karen’ Meme. Harvard Law Today.